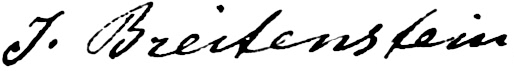Referat über das Verhältniß und die Wirksamkeit der freiwilligen und der gesetzlichen Armenpflege.
Jonas Breitenstein, Pfarrer in Binningen
Vorgetragen vor der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft in Liestal, den 20. September 1854.
Herr Präsident!
Hochgeachtete Herren! Liebe Eidgenossen!
Vor der Direktion der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft sind dieses Mal im Gebiete des Armenwesens folgende Fragen zur Behandlung vorgeschlagen worden:
1) In welcher Weise unterscheidet sich die Wirksamkeit der auf privater Wohlthätigkeit begründeten Armenpflege von der gesetzlichen:
a. in moralischer,
b. in national-ökonomischer,
c. in politischer Beziehung?
2) Könnte der Privatwohlthätigkeit die Armenpflege ganz oder theilweise mit Nutzen anheimgestellt werden, und in letzterm Falle
3) Welche Theile sollen ihr und welche der gesetzlichen zufallen, und welche Mittel stehen beiden zu Gebote?
Über diese Fragen hat nur die gemeinnützige Gesellschaft von Zürich ausführliche Verhandlungen und ein durch logische Schärfe der Gedanken wie durch treffende praktische Winke ausgezeichnetes Referat des Hrn. Pfarrer Heinrich Hirzel in Höngg eingesandt, welches letztere vorzüglich in dieser Arbeit ist benutzt worden.
Nicht minder wurde berücksichtigt die von erwähntem Referenten empfohlene Schrift des Hrn. Pfarrer Joh. Hirzel in Bauma: «Über die verschiedenen Systeme der Armenpflege.» Den vielen trefflichen, aus reicher Erfahrung und Lebensbekenntniß geschöpften Beobachtungen, die darin mitgetheilt sind, hätte ich gern noch mehr Ihre Aufmerksamkeit zugewendet, als es leider Raum und Zeit mir hier gestatten.
Auch hatte Hr. Landammann Hungerbühler in St. Gallen die Güte, mir seine Schrift: «Geschichtliches über das St. Gallische Armenwesen» zuzusenden, aus deren zweitem Theil besonders ich ebenfalls manch beherzigenswerthes Wort in dieses Referat habe einfließen lassen.
--------------------------------
So viel schon über das Armenwesen geredet und geschrieben worden, und so sehr einem bei derartigen Verhandlungen die Frage sich aufdrängt, ob statt allen Redens und Verhandelns es nicht besser wäre, gleich zu handeln, wo und wie die Gelegenheit sich bietet und soweit unsere Kräfte reichen, so dürfen wir auf der andern Seite nicht vergessen, daß es auch auf diesem Gebiete Lebensfragen gibt, die das reiflichste Nachdenken fordern, und über welche hinwegzugehen oft schlimme Folgen nach sich ziehen kann. – Eine solche Lebensfrage ist nun gewiß auch die von der Direktion unserer Gesellschaft ausgeschriebene über das Verhältniß der zwei einander entgegengesetzten Systeme der Armenpflege. Es ist auch die Wahl dieses Themas von vielen hochverehrten Gliedern dieser Gesellschaft begrüßt und die Frage «als eine zeitgemäße der gründlichsten Untersuchung und Erörterung würdig» erfunden worden. Und gewiß, wenn nicht nur aus Britannien und von den Lehrstühlen Deutschlands, wenn selbst von den Rathssitzen unseres eigenen Vaterlandes herab solch schwere Beschuldigungen gegen das bisher übliche System der Armenpflege ergehen, wie wir sie neulich haben hören müssen; ja, wenn man hie und da mißtrauisch dieses System als ein verwerfliches verlassen hat, um am Ende doch wieder nach traurigen Erfahrungen zu demselben hinzulenken: dann ist es heilige Pflicht jedes denkenden Mannes, hier ernstlich zu prüfen und das Beste zu behalten, dann mag der Gegenstand auch einer Besprechung im Schooße dieser Gesellschaft würdig sein.
Um so mehr aber fühlt Ihr Referent, als ein junges Mitglied einer jungen Abtheilung Ihrer Gesellschaft im Bewußtsein seiner jugendlichen Schwäche und Unvollkommenheit sich gedrungen, Sie alles Ernstes um Ihre freundliche Nachsicht zu bitten, wenn der vorzulegenden Arbeit jene Reife und Gründlichkeit abgeht, die Sie sonst billig von einer solchen verlangen. Doch zur Sache! ―
Der Gegenstand unserer Verhandlung, der im Programm in drei Fragen zergliedert ist, zerfällt genau genommen nur in die beiden Hauptfragen:
1) Ob der Privatwohlthätigkeit die Armenpflege ganz oder theilweise mit Nutzen könnte anheimgestellt werden, und
2) Welche Theile im letztern Fall der einen und der andern Armenpflege zufallen sollen und welche Mittel jeder derselben zu Gebote stehen.
Die erstere Frage hat aber zu ihrer nothwendigen Voraussetzung die in Lemma 1 geforderten Untersuchungen, so daß wir in der Behandlung unseres Themas ganz der angegebenen Ordnung folgen können.
Also, ob eine rein freiwillige, oder eine rein gesetzliche Armenpflege, oder beide mit einander verbunden theoretisch und praktisch das Richtige sei, diese Frage soll in Folge der Vergleichung beider Systeme beantwortet werden. Hiebei wird, wie Hr. Heinrich Hirzel bemerkt, das Wesen der freiwilligen und obligatorischen Armenpflege als bekannt vorausgesetzt, und man fordert sogleich unsere Ansicht über ihr gegenseitiges Verhältniß. Von dieser Voraussetzung können wir aber deswegen nicht so ganz ausgehen, weil es am Tage liegt, daß viel Grund des Streites auf diesem Gebiet in der theils einseitigen, theils vagen Bestimmung des Wesens des einen oder des andern Systems zu suchen ist.
Um aber dieses Wesen zu bestimmen, dürfen wir nicht das fertige System nehmen, bemerkt Hirzel richtig, und ihm einige wesentliche Merkmale abstrahiren, sondern begriffen wird das Wesen nur aus seiner historischen Genesis. Indem er diese weiter verfolgt, macht er die Beobachtung, daß die gesetzliche Armenpflege wesentlich ein Produkt des germanischen nördlichen protestantischen Geistes sei, die freiwillige oder nicht staatlich organisirte Armenpflege dagegen sich mehr dem romanischen südlichen katholischen Geiste eigne; und zieht er endlich den sehr wichtigen und richtigen Schluß: «Gesetzliche und freiwillige Armenpflege, jedes ist ein Produkt sehr weit und tiefgreifender Faktoren; einzelne Menschen, Staatsmänner, Pfarrer, Gesetzgebungen machen nicht das Eine oder das Andere; das wird gemacht von größern Mächten. In thesi können wir einen abstrakten Entscheid fällen; damit ist in praxi Nichts getan. Und ich halte es fast mit dem Philosophen, welcher sagte: «was ist, das ist vernünftig»; und das Volk sagt dasselbe in dem Worte: «kein Warum ohne Darum.»
Als wesentliche Merkmale der gesetzlichen Armenpflege gibt er an:
1. «Sie hat zur nothwendigen Voraussetzung die erbliche bürgerliche Heimatsberechtigung. Die bürgerliche Gemeinde legt sich selbst oder der Staat legt seinen Gemeinden die Pflicht auf, durch gesetzlich geregelte und gesicherte Unterstützung für die Armen, die ihr angehören, zu sorgen. Durch diese Sorge soll der Bettel und die Landstreicherei verhindert sein; letztere werden, wo die Armenpflege obligatorisch ist, konsequent verboten und bestraft.»
2. «Der gesetzlichen Armenpflege wesentlich sind ferner die obligatorischen Armensteuern nach gesetzlichem Maßstabe auf alle Bürger verlegt, mit Gesetzeszwang von Allen, die nicht selbst almosengenössig sind, erhoben. Diese Leistungen müssen entweder in Natura entrichtet werden, was durch sogenannten ‹Umgang› der Armen geschieht, meist aber in Geld.»
3. «Die Gesetzlichkeit bringt es mit sich, daß ihre Verwaltungsweise eine konforme, generelle, von einem Zentralpunkte aus sich gleichmäßig vertheilende, also respektive eine zentralisirte ist.»
Diesen drei Merkmalen der gesetzlichen Armenpflege gegenüber stellt er folgende drei der freiwilligen:
1. «Sie sieht ab vom Ortsbürgerrecht des Armen; sie nimmt den Armen als solchen, stamme er, woher er wolle. Dieß folgt aus ihrem Begriffe; sie beruht ja auf dem freien christlichen Erbarmen, und dieses sieht im nothleidenden Nächsten den leidenden Bruder und fragt nicht nach seinem Heimatschein, sintemalen wir alle aus derselben Heimat stammen.»
2. «Einem gesetzlichen Gemeinds- oder Staatsorganismus nicht eingefügt, bringt die freiwillige Armenpflege ihre Mittel auch nicht auf gesetzliche Wege zusammen, sondern durch freiwillige Steuern, welche sehr mannigfacher Art sind, deren Leistung, weil sie oft in Natura geschieht, oft auch leichter fällt als eine Steuer in Geld. Obdach, Kleider, Nahrungsmittel, guter Rath, der Geldes werth ist, verbinden sich mit den Leistungen in Geld.»
3. «Die freiwillige Armenpflege ist ihrer Natur nach dezentralisirt, individualisirt; so viele Pfleglinge, so viele Pfleger. Das persönliche Erbarmen, persönlich, insofern es im Individuum lebendig ist und auf das Individuum sich richtet, ist ja das Prinzip der Freiwilligkeit, welches all ihr Thun durchdringt.»
Diese Definition ist wohl klar und bestimmt genug, um uns das Wesen beider Systeme deutlich erkennen zu lassen. In der Wirklichkeit freilich werden sich manche Abweichungen zeigen, die deswegen das Wesen der Sache nicht alteriren. Wenn z. B. bemerkt wird, daß die Verwaltungsweise der gesetzlichen Armenpflege eine zentralisirte sei, so ist damit wohl nicht ausgeschlossen, daß sie hinwiderum in gewißem Sinne, wenn z. B. vom Verhältniß des Staates zu den einzelnen Gemeinden die Rede ist, dezentralisirt werden könne und müsse; oder wenn es heißt: das persönliche Erbarmen sei das Prinzip der Freiwilligkeit, so ist damit auch nicht gemeint, daß in allen Fällen freiwilliger Armenpflege auch jenes Erbarmen walte.
Fassen wir nun unser Thema näher in‘s Auge, so stellt wohl mit Recht Lemma 1 die Frage in den Vordergrund, wie sich die freiwillige Armenpflege von der gesetzlich in moralischer Beziehung unterscheide; denn was unsittlich und – möchten wir hinzufügen – unchristlich ist, muß uns aus dem Grunde schon verwerflich erscheinen und umgekehrt.
Es geht nun aber die Frage nicht sowohl auf das Prinzip, das der einen oder andern Armenpflege zu Grunde liegt, als vielmehr auf die sittlichen Wirkungen im Leben. Nichts desto weniger möchten wir, durch die Frage darauf aufmerksam gemacht, zunächst von jenem reden. – Das Prinzip der christlichen freiwilligen Armenpflege ist die hingebende Liebe, wie sie unser Herr und Meister uns geboten, wie er sie selbst geübt hat und wie er sie noch immer wirkt in den Gläubigen. «Die staatlich gesetzliche Armenpflege dagegen», wie Hr. Joh. Hirzel es richtig bezeichnet, «hat zu ihrem Grund vorzüglich das Utilitätsprinzip, als Zweck die Abwendung von gewißen Übeln der Gesellschaft, die nun als Staat zu ihrem Schutz und zu ihrer Erleichterung durch Organisation einer gesetzlichen Armenpflege die geeigneten Maßregeln ergreift.» Ist diese Definition des Verhältnisses, wie es prinzipiell gefaßt werden muß, richtig, so verdient in dieser Beziehung die freiwillige Armenpflege um so viel mehr den Vorzug vor der gesetzlichen, als die freie christliche Liebe sittlich höher steht denn die berechnende Klugheit, die oft dem Egoismus dient. Ja, insofern nach christlichem, selbst nach allgemein menschlichem Gefühl eben nur das Erbarmen und die Liebe das reine Motiv aller Wohlthätigkeit und somit auch aller Armenpflege sein kann, verdient in prinzipieller Hinsicht die freie christliche Armenpflege allein Berechtigung.
Anders gestaltet sich freilich die Sache, wenn wir auf die Wirklichkeit und das Leben hinsehen. Hier wird dieser Vorzug der freiwilligen und jener Nachtheil der gesetzlichen Armenpflege bedeutend modifizirt schon durch die Thatsache, daß auch der freiwilligen Armenpflege oft und viel ein gewißes Utilitätsprinzip zugrunde liegt, indem man oft aus gewißen Rücksichten der Nützlichkeit thut, was den Schein des freien Erbarmens hat; so wie wir auf der andern Seite nicht allen Vertretern der gesetzlichen Armenpflege unbedingt den Vorwurf machen möchten, daß sie nur aus äußern Rücksichten und nicht vielleicht auch gerade aus weitherziger christlicher Liebe diesem Systeme huldigen.
Was aber der gesetzliche Armenpfleger gegenüber der freiwilligen auch eine prinzipielle Berechtigung gibt, das ist, wie das Referat von Zürich deutlich es darthut und wie auch Hr. Hungerbühler es andeutet, die historische Nothwendigkeit, wie sie geworden. Das Bettler- und Landstreicherunwesen erforderte polizeiliche Maßregeln, diese riefen am Ende die gesetzliche Armenpflege hervor. Und dieß zwar gewiß nicht nur in Folge davon, daß der Staat usurpirte, was ihm nicht zukam, sondern wie Hungerbühler bemerkt, in Folge der veränderten Zustände und des Mangels an jener Liebe, auf der die freie Armenpflege beruht. Darin liegt die Berechtigung der obligatorischen Armenpflege, durch das Gesetz zu bewirken, was ohne das Gesetz nicht geschähe, obwohl es im christlichen Staat geschehen muß. Das Ursprüngliche und Normale ist allerdings die freie Armenpflege, «und diese», sagt Hr. Joh. Hirzel, «hat eigentlich keinen Nachtheil als denjenigen, den man etwa an einem köstlichen Gericht bei einer Mahlzeit tadelt, nämlich, daß dessen zu wenig sei für den Hunger.» Die gesetzliche Armenpflege dagegen ist, wenn Sie wollen, «ein nothwendiges Übel.» Schluß aus Allem ist, was die erste Thesis des Zürcher Referates sagt: Freiwillige und gesetzliche Armenpflege als praktisch ausgeführte Systeme sind Produkte großer nationaler Faktoren und können daher nicht willkürlich mit einander vertauscht werden.
Hier aber begegnen wir bedeutenden Vorwürfen, die der gesetzlichen Armenpflege in Beziehung auf ihre moralischen Wirkungen gemacht werden. Gerade dieser Mangel an christlicher Liebe wird als eine verderbliche Folge der gesetzlichen Armenpflege dargestellt, die mit derselben verschwinden müßte. «Es ist wohl begreiflich», sagt Hr. Dubs, «daß die Quellen der Wohlthätigkeit gegenwärtig sparsamer fließen, da der Staat zwangsweise so viel vorabschöpft.» Der demoralisirende Einfluß der gesetzlichen Armenpflege auf die Unterstützenden wird darin gefunden, daß sie die natürliche Erbarmung ertödtet und hartherzig macht. «Was noch schlimmer ist als die materielle Beeinträchtigung der Wohlhabenden», sagt Baumgarten, «ist die Entfremdung, welche eben durch dieses (gesetzliche) Armenwesen bei ihnen gegen die Armut erzeugt wird. Wenn die Hauptleistung der Wohlthätigkeit zwangsweise geschieht, so erzeugt dieß zum weitern Wohlthun natürlicherweise Unlust.»
Wie wahr dieses Urtheil sei, zeigen am besten folgende aus dem Leben gegriffene Bemerkungen von Joh. Hirzel: «Die eigentliche Wohlthätigkeit wird unterdrückt durch die rechtlichen Ansprüche, die an sie gemacht werden. Da heißt es sogleich: ich muß sonst schon genug zahlen. – Die Armen werden ihren Mitbürgern schon als Bedürftige ein Dorn im Auge. – Im Jahr 1848 mußten in einer Gemeinde nur für Gemeinde-, großentheils Armensteuern 1023 Rechtsbote angelegt werden, wozu es freilich eine energische Gemeindeverwaltung brauchte. Man kann sich denken, was es da für Seufzen und Fluchen gegeben hat. Was für ein Segen aber kann in so zusammengebrachten Almosen und solchem Fluchgeld liegen? Dennoch ist das natürliche Mitleid nicht ganz zu unterdrücken. Das äußert sich dann aber so, daß man zu einem bekannten Nöthigen sagt: «Du Narr, geh‘ doch an den Stillstand, wir werden nicht um sonst so viel zahlen müssen.» Um den Widerspruch zwischen dem Klagen über die Ausgaben und dagegen diesem Zuweisen zur Vermehrung derselben kümmert sich dann freilich der Einzelne wenig. – Diese letztere nur allzu wahre Bemerkung kann selbst auch da gemacht werden, wo hinlängliche Armenfonds bestehen, die durch andere weniger als Armensteuern die Einwohner belästigende Einrichtungen geäufnet werden. Auch da weist man Alles getrost an die Armenkasse, als ob sie ein Oelkrüglein wäre, das nimmer ausgeht, und ein Dispens für alle Pflichten christlicher Liebe.
Die Armenbehörde selbst aber, von allen Seiten bestürmt und in ihrer schwierigen Doppelstellung, die Interessen des anvertrauten Gutes zu wahren und doch auf der andern Seite allen die Kräfte der Kasse weit übersteigenden Anforderungen Rechnung zu tragen, öfter rathlos, wird entweder zu hart gegen die auch unschuldigen Armen, oder sie nimmt’s zu leicht mit dem ihr anvertrauten Gut, wozu wir wohl auch im eigenen Kanton manche Belege finden könnten. «Bei reichen oder genügenden Armengütern», sagt Joh. Hirzel, «wird man oft zu leicht und zu viel geben, um des Andringens los zu werden, oder auch in einem gewißen schmeichelnden Gefühl, sich als Wohltäter zu zeigen, das ja nicht einmal etwas kostet. – Wo aber die Armenpflege, zwar nicht meistens mit liederlichen Armen, doch am meisten mit solchen zu tun hat, da wird sie eben mißstimmt und durch viele Täuschungen mißtrauisch, und sieht so von vorneherein fast jeden Petenten an. Der Armenpfleger ohne Lammessinn muss oft aufgebracht und erbittert werden, und das haben denn auch die unschuldigsten Armen zu spüren. Auch denen werden die Gaben oft verbittert durch gehässige Informationen und knickerisches Helfen. Aber die Mißstimmung ist doch gewiß zu entschuldigen, wenn z. B. vor einem Stillständer, der in seiner Jugend noch barfuß und mit kurzen Lederhosen in die Kirche wanderte, eine Dame mit Shawl und Sonnenschirm steht, fordernd und zankend wegen der Unterhaltung ihres dritten unehelichen Kindes, etwa auch begleitet von einem eleganten beschnauzten Liebhaber aus dem Schwabenlande u.s.w.» Ähnlich zeichnet Dubs die rathlose Stellung der Armenbehörden in dieser Beziehung.
Um alles dieß kurz zusammenzufassen, geben wir die Aufzählung, wie sie im Referat von Zürich uns vorliegt. Die gesetzliche Armenpflege ertödtet die natürliche Erbarmung und macht hartherzig gegen die Armut. Sie trägt unmittelbar zur Verarmung und somit mittelbar auch zur Entsittlichung des noch nicht almosengenössigen Volkstheils bei. – Sie zwingt die Armenbehörden zwischen verschuldeten und unverschuldeten, unwürdigen und würdigen Armen einen allzu geringen oder gar keinen Unterschied zu machen, sie verleitet dieselben das eine Mal zu mißbräuchlicher Strenge, das andere Mal zu mißbräuchlicher Laxheit, und löscht überhaupt den Geist aus in unsern Stillständern und Pfarrern (in den letztern bei uns, soll ich sagen: leider? nicht), die durch sie zu Verwaltungs- und Polizeimännern entwürdigt werden.
Noch schlimmer verhält es sich mit dem moralischen Einfluss auf die Unterstützten. «Bei denen», sagt Joh. Hirzel, «treten an die Stelle von Bitte und Dank Rechtsansprüche, zwar seltener mit bestimmtem Bewußtsein eines Rechtes, aber doch mit Berechnung und Forderung, wodurch das gemütliche und moralische Verhältniß zwischen Geber und Empfänger zerstört wird.» Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß an jener in vielen Armen schon so tief eingewurzelten Meinung, die Wohlthätigkeit der Wohlhabenden unter allen Bedingungen als eine Pflicht derselben in Anspruch nehmen und ihnen grob begegnen zu dürfen, wenn sie dieselbe nicht erfüllen, die gesetzliche Armenpflege, die diesen Grundsatz proklamiert, nicht wenig schuld ist. – Was aber das Schlimmste ist, das ist der Umstand, daß die Unterstützung der gesetzlichen Armenpflege eine so rein äußerliche ist ohne die Mittel und die Kraft, die wirkliche Noth zu heben. «Der gesetzlichen Armenpflege will das nie recht gelingen», sagt Hr. Dekan Häfeli, «die rechte religiöse moralische und polizeiliche Einwirkung mit ihren Gaben zu vereinigen. Die Gesetzgebung kann über diese Wirksamkeit, die ganz individueller Natur ist, nichts vorschreiben.» Um die Wahrheit dieser Worte zu erhärten, brauchen wir von vielen Beispielen nur an das zu erinnern, wie von den Gemeinden arme Kinder, als wären’s unvernünftige Geschöpfe, an den Mindestbietenden mit Leib und Seele verkauft werden, wodurch in progressiver Weise das Übel vermehrt wird. Das thut eine freie Armenpflege nicht, sie weiß es, daß sie für Menschenseelen zu sorgen hat. Die verschämten Armen aber, denen durch die verborgene Hand der Privatwohlthätigkeit im Falle der Noth ohne Schaden für ihr sittliches Gefühl könnte geholfen werden, müssen sich vor der Armenpflege herabgewürdiget sehen, wenn sie mit den Schlechtesten in eine Linie gestellt werden, und ihr Ehrgefühl wird abgestumpft, wenn sie vor einer ganzen Gemeinde als Almosengenössige erscheinen. Die Lasterhaften dagegen haben in den Folgen ihres Leichtsinns, in der oft so heilsamen Noth kein Mittel der Besserung mehr, da ihnen ja geholfen werden muss. Sehr wahr sagt Baumgarten: «Die unverschuldeten Armen sollten durch die Anerkennung ihrer Persönlichkeit über den Druck der Gegenwart getröstet werden, aber das Armenwesen behandelt sie als Nummern ihrer Register; entweder darben sie nun lieber oder müssen sich in ihrem innersten Wesen gebrochen fühlen. Die selbstverschuldeten Armen, die ihre Seele bereits an irgend eine sinnliche Lust verkauft und das Band ihrer Familie in den meisten Fällen zerrissen haben, werden durch die äußerliche und veräußerlichende Behandlung des Armenwesens in der Regel nur bestärkt in ihren Sünden und Lastern. Es ist eine allgemeine Wahrnehmung und Klage der Armenkollegien, daß verhältnißmässig am meisten von der Armenunterstützung auf die unehelichen Geburten und Kinder liederlicher Mädchen verwandt wird.» Wie sehr auch die Bande der Familie gelockert und oft aufgelöst werden durch das Gesetz, das zeigen jene Beispiele, wenn Eltern mit Berufung auf dasselbe den Gemeinden drohen, ihnen ihre Kinder anzuhängen, oder wenn Kinder einen alten hilflosen Vater obdachlos in der Gemeinde stehen lassen, weil das Kostgeld für denselben zu gering sei. Jedenfalls muß solche gewisse Aussicht auf Unterstützung, wie die gesetzliche Armenpflege sie bietet, Viele leichtsinnig und in der Jugend unbesorgt machen für ihre alten Tage.
Dieß sind die Schattenseiten der gesetzlichen Armenpflege in moralischer Beziehung, die wir nicht in Abrede stellen können, wenigstens diejenigen unter uns nicht, welche nicht etwa nur von aussen oder vom Kanzleitische, sondern in der Wirklichkeit sie haben kennen lernen. Eine andere Frage ist nun aber die, wie mit diesen ihren Schattenseiten die gesetzliche Armenpflege sich zu der freiwilligen stellt, und ob diese mit ihren moralischen Einflüssen so viel besser stehe als jene, daß sie zur alleinigen Übernahme der Armenpflege berechtigt erscheinen kann.
Zuerst ist aber zu bemerken, daß man gewiß der gesetzlichen Armenpflege Unrecht tut, wenn man alle die traurigen Erscheinungen der Zeit, die irgendwie mit ihr zusammenhangen, ihr allein die Schuld gibt, weil frühere Zeiten unter der freiwilligen Armenpflege solche Zustände nicht zeigen. Abgesehen davon, daß letzteres sehr relativ zu nehmen ist, und wohl Niemand unter uns im Ernst jene guten alten Zeiten mit der löblichen Zunft der fahrenden Schüler, mit der Schar der frommen Bettler und mit allen ihren zerfallenen Heiligtümern zurückwünschen wird, abgesehen davon ist wohl zu bedenken, es haben sich gegenwärtig die Verhältnisse so sehr geändert und es ist ein so größerer Umschwung im Menschheitsleben eingetreten, daß eine Armenpflege, die damals der Armut nicht besser zu steuern wußte, heutzutage wohl auch völlig rathlos wäre. Die große Zunahme der Bevölkerung, die mit Riesenschritten fortschreitende Industrie und ihre das Leben gänzlich umgestaltende Macht, der großartige Mechanismus in allen Gebieten des Lebens, die seit einem halben Jahrhundert in die Menschheit geschleuderten und noch nicht durchgekämpften Ideen – der Geist der Zeit – das, verehrteste Herren und Freunde, sind nach meiner innersten Überzeugung die Gebiete, in denen ebenso zu jenem Produkte die Faktoren liegen, welche man vergeblich in einem einzelnen System zu suchen bemüht ist. Die Grundursache alles Übels wie überall so auch hier ist die Sünde aber «die unserer Zeit eigenthümlichen und allgemeinen Veranlassungen der zunehmenden Verarmung», sagt Joh. Hirzel, «sind gerade die Fortschritte dieser Neuzeit, die größere Freiheit und Beweglichkeit in allen Gebieten des Lebens.»
Sehr zu beherzigen sind auch die hierauf bezüglichen nur von einer andern Seite die Sache beleuchtenden Bemerkungen Hungerbühlers. Er zeigt, wie die Armut wenigstens in seiner Heimat seit 200 Jahren nicht unverhältnißmäßig zugenommen und «daß jedenfalls die Armenunterstützungsmittel – die Mittel für Verminderung und Linderung der Noth und des Elends, die Assekuranz-, Ersparniß-, Alters-, Lebensversicherungs-, Kranken-, Wittwen- und Waisenkassen und das gesamte Nationalvermögen Schritt für Schritt sich in gleichem oder noch höherm Maße vermehrt haben. «Wer», fragt er, «möchte z. B. behaupten, daß es heutzutage mehr arme Taubstummen und Irre gebe, weil sie jetzt in Taubstummen- und Irrenanstalten versorgt werden, während man weiland kaum von dieser unglücklichen Armenklasse sprach, geschweige sie versorgte? Dieses Armenelend nahm darum nicht zu, weil man es jetzt als solches anerkennt und zur Abhilfe oder Linderung desselben Anstalten errichtet. Auch ist nicht zu leugnen, daß sich die zum Wohlsein als nötig erachteten Bedingungen erweiterten. Man betrachtet jetzt als einen Zustand der Armut, was früher die Lage eines Wohlhabenden war.»
Anknüpfend an diese Bemerkungen müssen wir nun der Behauptung gegenüber, daß die gesetzliche Armenpflege die Wohlthätigkeit unterdrücke, doch auch die wahre Thatsache hervorheben, daß das Leben fast diese Behauptung zu widerlegen scheint, wenigstens dieselbe sehr beschränkt, indem wohl keine Zeit so reich war an mannigfaltigen und Allen zugänglichen Anstalten der christlichen Liebe, wie gerade diese Zeit der gesetzlichen Armenpflege. Zumal in unsern Gegenden besteht wohl bald kein größerer Ort mehr, wo nicht wenigstens ein bescheidener Frauenverein oder etwas der Art befände, und zwar nicht sowohl von aussen angeregt als aus innerm Trieb entstanden. Und wo irgendwie durch Kalamitäten Nothstände entstehen, finden wir immer viele willige Herzen und Hände. Es wäre Undank gegen Gott, dieses verkennen und aus Mißstimmung davor die Augen verschließen zu wollen.
Ebenso dürfen wir nicht übersehen die vielfachen Anstrengungen derer, die zwar noch nicht zur Klasse der Unterstützungsbedürftigen herabgesunken sind, es aber gar bald werden könnten, sich in gegenseitiger Unterstützung selber zu helfen durch Unterstützungs-, Kranken- und Sterbekassen, durch Konsumvereine u. dergl. Nicht nur wirken solche Anstalten wohlthätig dadurch, daß sie rechtzeitig eingreifen und größerm Übel vorbeugen, sie erwecken auch edlern Sinn und reges selbständiges Streben in den Betheiligten. Sie sind aber ein lebendiger Beweis dafür, daß eine vernünftige beschränkte gesetzliche Armenpflege dem Leichtsinne wohl nicht mehr Vorschub leistet, als es leider jede freiwillige auch tun wird. Vollkommen wahr sagt Joh. Hirzel, «daß die Aussicht auf gesetzliche Unterstützung, besonders wenn diese mit polizeilicher Aufsicht und Repressivmaßnahmen verbunden ist, viele im Allgemeinen nicht leichtsinniger mache als die Hoffnung auf freie Almosen, wenn überhaupt hier zum Voraus eine bewußte Rechnung stattfindet. Der Leichtsinn denkt eben gar nicht an die Zukunft, und hat höchstens die allgemeine Voraussetzung: es wird immer gehen und wieder geholfen werden.»
Überhaupt treffen die schweren Beschuldigungen meist nur die unbeschränkte gesetzliche Armenpflege, nicht aber die an gehörige Bedingungen geknüpfte und eingeschränkte Form derselben, wie man ihre Nothwendigkeit immer allgemeiner erkennt. Nach den Beobachtungen, die ich tagtäglich zu machen Gelegenheit habe, besonders in der Nähe Basels, dessen wohlthätigen Sinn und herrliches verborgenes Wirken auf diesem Gebiete ich hier gebührend anerkennen muß, kann ich behaupten, daß eine freie Armenpflege, wenn sie im Einzelnen auch noch so gewissenhaft geübt wird, ohne gehörige Organisation oft schädlicher wirkt als eine restringirte gesetzliche. Diese erweckt Ansprüche durch das in den Armen sich bildende Bewusstsein des gleichen Rechtes, jene durch die oft sehr aus Mißgunst hervorgegangene Meinung der gleichen Bedürftigkeit, nur daß bei der gesetzlichen Armenpflege es gewöhnlicher schwerer hält, von diesem Bewußtsein Gebrauch zu machen als bei der freiwilligen. Wenigstens kenne ich viele Beispiele, wo die Scheu vor einem Anklopfen an fremder Türe längst überwunden war, während man sich noch mit Händen und Füßen sperrte, vor der Gemeinde als Almosengenössige zu erscheinen, ein Umstand, der in anderer Beziehung freilich für die freie Armenpflege spricht.
Den Nachtheil wird die gesetzliche Armenpflege gegenüber der freien immer haben, daß sie in ihren Unterstützungen für das Wichtigste, für die sittliche und religiöse Erhebung nicht recht oder gar nicht zu sorgen weiß, wodurch doch allein gründlich geholfen werden kann. Nur die freie Wohlthätigkeit hat ein besonderes Interesse für die Versorgten und geht ihnen mit liebendem Auge nach. In dieser Hinsicht wirkt dieselbe, besonders wo sie durch Vereine organisirt ist, mit einem Segen, der der gesetzlichen völlig abgeht. Aber eben nur Einzelne werden dieses Segens theilhaft, während Andere um so mehr verkümmern, und nur von Einzelnen wird solche Weisheit mit der Liebe verbunden, wenn sie wohlthun. Gesetzt aber, die Armenpflege würde ganz der Privatwohlthätigkeit anheimgestellt, und auf sie würfe sich der ganze Andrang der Unterstützungsbedürftigen; - wo wären die Vielen, welche Zeit, Lust und Geschick hätten, so wie es nothwendig wäre, die Überwachung ihrer Pfleglinge zu besorgen? Daß es an einzelnen Orten und von einzelnen Hochbegabten geschieht, berechtigt uns nicht zur Hoffnung, daß es auch im Allgemeinen geschehen werde. Vielmehr wird es wie bisher in den meisten Fällen dabei bleiben, daß man den Supplikanten entläßt mit einer Gabe und damit glaubt, das Seinige getan zu haben. Und ebenso bürgt uns Niemand dafür, daß die Armen fürder nicht mehr sich jener persönlichen Einwirkung dadurch entziehen werden, daß sie wie bisher oft aus richtigem sittlichem Gefühl sich an diejenigen wenden, denen sie am wenigsten bekannt sind.
Die großen nachtheiligen Folgen einer solchen freien Armenpflege liegen so sehr auf der Hand, daß auch ihre eifrigsten Verteidiger sie nicht in Abrede stellen. Chalmers selbst behauptet, daß es nichts Schädlicheres gebe als öffentliches Almosenvertheilen; «Almosen wie Gebete», sagt er sehr schön, «sollen die Verborgenheit suchen, wo die Türen verschlossen sind, wenn die zwei oder drei, welche darum zusammenkommen, von Niemand als vom Vater im Himmel gesehen werden.» Deswegen verstehen sie alle unter der von ihnen als die allein richtige angepriesenen Armenpflege die kirchliche, wie sie weiland bestanden hat, und wie sie nach heutigen Bedürfnissen neu organisiert werden müßte. Doch hierüber das Nothwendige im Schlußergebniß dieser unserer ersten Frage!
Gehen wir nun zur Betrachtung des Verhältnisses in national-ökonomischer und politischer Beziehung über, so können wir uns hier etwas kürzer fassen, da manches hierauf Bezügliche schon im ersten Theile ist beleuchtet worden.
Was zunächst die national-ökonomische Seite der Frage betrifft, so wird in dieser Hinsicht der gesetzlichen Armenpflege von ihren Gegnern vorgeworfen, ihre letzte Konsequenz sei die Aufzehrung des Nationalvermögens. Den Beweis dieses Satzes geben wir, wie das Referat von Zürich nach dem Nationalökonomen Mill ihn uns mittheilt. «Die Grundlage, worauf die unbegrenzte gesetzliche Armenpflege ruht, ist die Voraussetzung, daß der Staat alle Armen ernähren könne, wofern er sie nur zur Arbeit anhalte. Diese Voraussetzung wäre eine richtige, d. h. der Staat könnte durch Steuern eine Ansammlung von Lohnfonds erzwingen und das Verhältniß zwischen Arbeit und Lohnfonds durch Vermehrung des Kapitals zum Vortheil armer Arbeiter ändern; das könnte der Staat und müßte es thun, wenn eine solche Anforderung auf die jetzt lebende Generation sich beschränken ließe. Aber das ist eben das Unglück, daß durch eine solche Verpflichtung, die der Staat übernimmt und durch deren Folgen alle positiven und präventiven Beschränkungen der Bevölkerungszunahme aufgehoben werden und daß dannzumal keine Macht mehr vorhanden ist, um die Volksvermehrung von der möglichst raschen Progression zurückzuhalten. Da sich nun mathematisch sicher beweisen läßt, daß die also rasch zunehmende Bevölkerung den Arbeitsertrag nicht in gleichem Maße vermehrt, so ist ebenso gewiß, daß nach einer genügend langen Zeit, wo die Volksvermehrung beständig fortgehen, der Mehrertrag dagegen immer mehr abnehmen würde, ein Überschuß ganz aufhören müßte. Die Besteuerung zur Unterstützung der Armen würde so mehr und mehr das Gesamteinkommen des Landes in Anspruch nehmen und die Bezahlenden und Empfangenden in eine Masse zusammenverschmelzen.
Hieraus folgt, daß die Gesellschaft die Bedürftigen unterhalten kann, wenn sie deren Vermehrung unter ihre Kontrolle nimmt. Wenn sie aber das letztere dem freien Willen der Bedürftigen überläßt, so muß sie auch diese selbst ihrer eigenen Sorge überlassen. Es ist nicht möglich, halb das Eine halb das Andere zu wählen; der Staat kann nicht ungestraft die Ernährung übernehmen und die Volksvermehrung sich selbst überlassen.»
Es weht uns diese ganze Beweisführung etwas fremdartig englisch an, und Jeder unter uns fühlt wohl, daß sie für unsere Zustände nicht so ganz gelte. Sie beruht aber auf den traurigen Erfahrungen, welche die englische Armengesetzgebung mit ihren Unterstützungen und Werkhäusern besonders vor 1833 hat machen müssen und ist für uns ein Fingerzeig, wohin eine gesetzliche Armenpflege, wenn sie nach Innen nicht weislich beschränkt, nach Aussen nicht behutsam gehandhabt wird, am Ende führen kann. Es gab in England Kirchspiele, deren reines Einkommen zur Hälfte, zu drei Vierteln, ja wohl ganz von ihren Dürftigen verschlungen wurde, und wo die Bevölkerung, durch solche Zustände heruntergedrückt, alles Streben verlor und in physischer und moralischer Beziehung ausartete. Hungerbühler führt an, wie schon unter der Regierung Karls II. die Armentaxe fast die Hälfte des ganzen Ertrages der Krone betrug. An lehrreichen, nach dem Leben gezeichneten Schilderungen, wie es unter einer solchen Armenpflege zuging, ist besonders Chalmers reich.
Aber auch eine restringierte gesetzliche Armenpflege kann solchen Übeln nicht leicht vorbeugen. «Der Arbeitslohn», fährt das Referat von Zürich weiter fort, «kann nur durch eine Vermehrung des zur Mietung von Arbeitern angewendeten Gesamtfonds oder durch eine Verminderung der Zahl der Arbeiter steigen, so wie anderseits nur durch eine Verminderung der zur Bezahlung von Arbeitern bestimmten Fonds oder durch eine Zunahme der Zahl der zu bezahlenden Arbeiter fallen. Diese Sätze sind so wahr, daß jeder wissenschaftliche und jeder praktische Versuch, sie umzustürzen, bisher nur zu ihrer Bewährung hat dienen müssen. Wenn sie den jetzt lebenden, sondern auch denen, die geboren werden, ja ausdrücklich den ‹hilflosen Kindern› ein Recht auf Unterstützung gibt – leistet sie nicht dadurch dem Leichtsinn in der Verheiratung und Kindererzeugung Vorschub? Vermehrt sie nicht dadurch die Zahl der sich Konkurrenz machenden Arbeiter? Vermindert sie nicht so den Arbeitslohn? Mehrt sie nicht das Elend der arbeitenden Klasse?»
Ähnlich argumentirt Hr. Dubs. Aus statistischen Vergleichungen weist er nach, daß es nicht die Kranken sind, welche den Gemeinden die großen Mehrkosten verursachen, daß dagegen die Alten und Gebrechlichen, in ganz besonders hohem Maße aber die Kinder den Gemeinden zur Last fallen. «Wenn man nun auch», sagt er, «im Gesetz bestimmt, daß liederliche Arme auf keine Unterstützung Anspruch haben, so ist dieß im Grund eine blosse Phrase, die der Wahrheit nicht entspricht; denn der Liederliche ist es doch, welcher der Gemeinde das Gesetz macht; die Behörden können nur die vorhandene Thatsache registrieren und – ausbezahlen. Es muß aber Jedermann einleuchten, daß man auf solche Art sich selbst die Hände bindet und den Leichtsinn förmlich herausfordert, welchen man dann hintennach mit polizeilichen Mitteln ohnmächtig zu bemeistern sucht. Hier löst sich Ihnen das Räthsel, daß der Staat, je mehr er tut, je besser er für die Armen sorgt, um so mehr Arme pflanzt; denn er bettet mit seiner Thätigkeit dem Leichtsinn nur auf bequemere Ruhekissen.»
Neben diesen wichtigen Bemerkungen möchten wir auch das anführen, daß als ein mächtiger Hebel des Wohlstandes jedes Einzelnen und somit auch des ganzen Staates, der Sinn für Sparsamkeit und Häuslichkeit genannt werden muß. Dieser wird sehr gekräftigt durch Sparkassen und Institute ähnlicher Art. «Ohne thätige Mitwirkung für ihre eigene Hebung gibt es keinen Weg der arbeitenden Klassen zu helfen, aber hiezu liegen die Mittel in ihrer Hand», sagt Chalmers sehr wahr und schön. Derselbe bemerkt aber weiter: «Dasselbe Prinzip, das unserer Verteidigung und Empfehlung von Sparkassen zu Grund liegt, macht uns zum Feind der Armensteuern; die ersteren sind Todfeinde der letzteren, indem Viele deshalb nichts dort anlegen, weil sie es ansehen, daß durch die Landesgesetze schon hinreichend für sie gesorgt sei.» «Als ein Armendeputirter», erzählt Otto von Gerlach, «die Leute zum Eintritt in einen Sparverein ermahnte, erhielt er zur Antwort: ‹Wozu sollen wir denn sparen? Wir haben ein Recht darauf, aus der Armenkasse unterstützt zu werden.› »
Hierauf bezieht sich auch, was Joh. Hirzel anführt: «Die Leute, die die Armensteuern zahlen müssen, kommen bei eigener Noth in schweren Zeiten desto eher auf den Gedanken, sie möchten nun auch einmal, nachdem sie lange eingezahlt, wieder etwas beziehen. Ja, ich habe schon öfters gehört, wie Einer sich nicht nur auf seine eigenen bisherigen Leistungen, sondern auf die Summen berufen hat, welche die Gemeinde von einem seiner Verwandten bezogen habe. In jedem Falle bekommt man die Äußerung hundert Mal zu hören: ‹Ich habe noch nie etwas von der Gemeinde gehabt›, wobei eben vorausgesetzt wird, daß eigentlich jeder Bürger auch etwas von der Gemeinde zu beziehen hätte. Es ist dieß überhaupt die Gesinnung, wie in jenem englischen Bettlerlied aus der Zeit der Elisabeth sich ausspricht: ‹Nun fahret zum Henker ihr Grillen und Sorgen; das Land ist uns schuldig, nun sind wir geborgen.› »
Mit diesen schweren Angriffen auf die gesetzliche Armenpflege in national-ökonomischer Beziehung verhält es sich ähnlich, wie mit denen in moralischer Hinsicht es sich verhielt und wie es sich auch auf dem politischen Gebiete verhalten wird. Sie gelten zunächst der unbegrenzten gesetzlichen Armenpflege, und in diesem Sinne müssen wir ihre Wahrheit vollkommen anerkennen. Wem müßte es aber nicht einleuchten, daß ein englisches Bastardgesetz, das für uneheliche Kinder Prämien aussetzte, oder ein englisches Armengesetz, das für träge Arbeiter eigene Werkhäuser errichtete, damit sie ungesorgtes Brot essen möchten, und das somit den Lohn der fleissigen herunterdrückte und ihre Existenz ihnen unsicher machte; wem sollte nicht einleuchten, daß ein in diesem Sinne durchgeführtes Gesetz nur die schlimmsten Folgen haben konnte? –
Hat aber die gesetzliche Armenpflege ihre nothwendigen Einschränkungen und wird sie mit Maß und Ziel vollzogen, so fallen die schwersten jener Anklagen weg. Sehr wahr sagt hierüber das Referat von Zürich: «Wenn die Hilfe in der Weise gewährt wird, daß die Lage der unterstützten Personen ebenso wünschenswerth ist als die desjenigen, der ohne Hilfe fortkommt, so wirkt die Hilfe, sofern sie systematisch und in der Art gewährt wird, daß vorher darauf gerechnet werden kann, nachtheilig. Lässt aber die Hilfe, obwohl Allen zugänglich, doch Jedem ein starkes Motiv, wenn irgend möglich, lieber allein fortzukommen, so ist sie meistentheils heilsam. Wenn bei voller Garantie gegen wirkliche Noth die Lage der öffentlichen Unterstützung Empfangenden beträchtlich weniger begehrenswerth gemacht wird als die derjenigen, welche sich selbst unterhalten, so können nur gute Folgen aus einem Gesetze entstehen, das Jedem den Tod aus Mangel, sofern er ihn nicht selber wählt, unmöglich macht. Auf diese Grundlage ist das englische Armengesetz von 1834 gebaut. Es wirkt bereits sichtlich wohlthätig; die Zahl der Unterstützten nimmt ab, die Armentaxe vermindert sich, jene oben beschriebenen Distrikte erholen sich, so daß die Schilderungen aus dem Jahre 1833 schon nicht mehr auf sie passen.»
Allerdings wird auch eine beschränkte gesetzliche Armenpflege die oben angeführten Mißstände nicht alle zu beseitigen im Stande sein, und es wäre Thorheit, wenn der Staat sich hier anmaßen wollte, alle Wege zu ebnen. Doch wird viel von dem Gesagten sehr zu beschränken sein, insofern es nämlich der Armenpflege allein zur Last gelegt wird. Daß z. B. an jenem Leichtsinn bei Schließung der Ehen und der Kindererzeugung, daß an jenem Mangel häuslichen sparsamen Sinnes, wodurch allerdings die Armennoth vergrößert und die Wohlfahrt untergraben wird, nur das Armengesetz Schuld sei, das muß ich wenigstens im Hinblick auf unser Land und unsere Verhältnisse in den meisten Fällen bezweifeln. Ich bin z. B. überzeugt, daß in unserm Kantone, wo leider so viele frühe und leichtsinnige Ehen geschlossen werden, an diesem Übelstande ausser der Hauptursache, einem unsittlichen leichtfertigen Sinn weit mehr die freilich in vielen Fällen falsche Aussicht auf ein genügendes Fortkommen bei der leichten Art sich eine Existenz zu verschaffen, Schuld sei, als irgendwelche Hoffnung auf gesetzliche Unterstützung; und die meisten angehenden Eheleute dieser Art würden es einem sehr übel nehmen, wenn man die Sicherheit ihres künftigen Fortkommens irgendwie bezweifeln wollte. Es gilt auch hier, was oben schon bemerkt wurde, der Leichtsinn denkt eben gar nicht an die Zukunft.
Ähnlich verhält es sich wohl mit den sogenannten Rechtsansprüchen, die durch die gesetzliche Armenpflege erweckt werden sollen. Sehr wahr sagt Joh. Hirzel: «Wenn gar keine gesetzliche Armenpflege wäre, so würden ja auch die Selbstverschuldeten an die Privatwohlthätigkeit sich wenden, und es bliebe doch ein gewisses Muß, wo einmal Noth und Mangel und Hunger, verschuldet oder unverschuldet, vorhanden ist, ein nicht nur moralisches, sondern äußeres fast zwingendes Müssen nach allgemeinem Gefühl der Begehrenden und des Publikums. Und so würde die freie Liebe sehr unfrei, ja fast noch unfreier als die gesetzliche Armenpflege, und hätte nicht einmal so viel Kraft und Recht als diese»; und bezeichnend ist das Wort, das Hr. Professor Zyro anführt: «Sei die Armenunterstützung gezwungen oder freiwillig, die Armen fragen dem nicht viel nach, sie fordern.»
Wenn wir aber auch immerhin zugestehen, daß die gesetzliche Armenpflege viele solcher großen Nachtheile habe, wie wir die nach den aus dem Leben entnommenen Beobachtungen oben aufgezählt haben, so müssen wir doch behaupten, daß sie mit diesen ihren Nachtheilen gegenüber der freiwilligen nicht so ganz im Nachtheil stehe. Die letztere nämlich, wie das Referat von Zürich es ausspricht, thut stets entweder zu viel oder zu wenig, hier verschwendet sie ihre Güte, dort läßt sie die Leute verhungern. Unter solchen Umständen ist aber alsdann dieß Überhandnehmen des Bettels unvermeidlich, von dem Heinrich Hirzel sagt, daß er «vielleicht überhaupt die Achillesferse der freien Armenpflege sei.» Ob aber dieser, wenn er einmal einreißt und wie es gewöhnlich geschieht, ganze Familien und ganze Gemeinden in die verderbliche Gewohnheit hineinzieht, der allgemeinen Wohlfahrt und dem Nationalvermögen minder schade als jene gerügten Folgen der obligatorischen Armenpflege, das überlasse ich Jedem unter Ihnen sich selbst zu beantworten.
Was überhaupt über das Verhältniß von gesetzlicher und freiwilliger Armenpflege in national-ökonomischer Beziehung gesagt werden kann, beleuchtet am besten das Referat von Zürich in folgenden Fragen: «Was wirkt nachtheiliger auf die Energie und Betriebsamkeit einer arbeitenden Bevölkerung, die für den äußersten Nothfall eröffnete Aussicht auf Hilfe, oder aber der Entzug dieser Aussicht? Was ist schlimmer: eine Klasse gesetzlich Unterstützter oder Haufen von Bettlern? Welche Länder sind die produktivern, industriellern, vermöglichern, die germanisch-protestantischen oder die romanisch-katholischen? – Aus den Früchten erkennt Ihr den Baum!»
Was endlich das Verhältniß zwischen freiwilliger und gesetzlicher Armenpflege in politischer Beziehung betrifft, so sind auch hier die Angriffe auf die letztere heftig. Es ist eine schwere Anklage, die ein Freund der kirchlichen Armenpflege gegen sie führt, wenn er sagt: «Der Staat kann um so weniger diesen furchtbaren Zwist zwischen Wohlhabenden und Bedürftigen gleichgültig ansehen, da das dem Armenwesen zu Grunde liegende und wirksame Prinzip ein alles Staatsleben gefährdendes und vernichtendes ist. – Gewiß wirkt die ganze Büchersaat der sozialistischen und kommunistischen Literatur nicht so auflösend, wie das Institut des regulierten Armenwesens, weil dieses den falschen und gottlosen Gedanken einer Gleichmachung menschlicher Vermögensunterschiede fortwährend in die Praxis einführt und zwar unter obrigkeitlicher Sanktion.»
Hier ist der Gedanke ausgesprochen, daß die gesetzliche Armenpflege in ihren Konsequenzen die Selbstvernichtung des Staates sei. Indem sie den Armen das Recht gibt zu fordern, vernichtet sie das Eigenthumsrecht und führt zur Gemeinschaft der Güter. Konsequenterweise führt sie auch zur Centralisation, und diese, statt das Übel zu heben, verallgemeinert es nur auf bedenkliche Weise. Letzteres beweist Hr. Dubs folgendermaßen: «Einzelne Gemeinden werden durch die Armenausgaben beinahe erdrückt und mit Steuern belastet, welche mit den andern öffentlichen Ausgaben in gar keinem Verhältnisse stehen; während andere Gemeinden so glücklich sind, von dem Übel des Pauperismus fast gar nichts zu empfinden. Die daherige Ungleichheit wird in der Dauer in diesem Maße schwerlich haltbar sein. – Die Centralisation ihrerseits würde dagegen eine viel gleichmäßigere und gerechtere Vertheilung der Armenlasten mit sich führen. Hierin liegt ihr Vorzug, dem aber anderseits eine dunkle Schattenpartie beigesellt ist, nämlich die, daß man mit der Centralisation das Übel nicht hebt, sondern nur verallgemeinert.»
Sollten auch diese Konsequenzen nicht zugegeben werden, so wird doch das als unbestrittene Thatsache hingestellt, daß gerade die für ein gesundes republikanisches Staatswesen gefährliche Büreaukratie durch die gesetzliche Armenpflege begünstigt und gekräftigt werde, «wenn das Freieste und Geistigste im Menschen, seine Liebe und sein Erbarmen in die Zwangsjacke von Gesetzen und Reglementen, von büreaukratischen Normen und Maßregelungen eingeschnürt wird.»
Was nun die erstere Behauptung betrifft, daß das gesetzliche Armenwesen zum Ruin des Staates führe, so müssen wir mit dem Referat von Zürich sagen: «Die Gegner der gesetzlichen Armenpflege machen sich ihren Angriff zu leicht, indem sie denselben auf einen Popanz richten, statt auf das, was ist. Jene Angriffe auf die gesetzliche Armenpflege gehen alle von der Voraussetzung aus, daß dieselbe ganz sinn- und verstandlos samt den gerechten auch alle ungerechten Ansprüche befriedigen zu wollen erkläre.» Wäre letzteres der Fall, dann wäre allerdings das Prinzip des gesetzlichen Armenwesens ein kommunistisches; beschränkt sie aber das Recht des Armen auf gehörige Weise und fordert sie von Wohlhabenden nur, was er aus freiem Willen ohnehin pflichtgemäß tun sollte, so kann ich wenigstens darin keine verderblichen kommunistischen Grundsätze erblicken.
Wahr ist es allerdings, die Gefahr der Centralisation und somit der Verallgemeinerung des Übels liegt diesem Systeme nahe; denn derselbe Grundsatz, der in den einzelnen Gemeinden für die Pflichten der Bürger gilt, kann konsequenterweise geltend gemacht werden wollen oder müssen für die Gemeinden untereinander. Die Gefahr der Centralisation sehen auch eifrige Verteidiger der gesetzlichen Armenpflege ein. «Zwischen dem System der modernen Staatsarmenpflege und der alten, in den bekannten heillosen Landbettlervagabundismus ausgearteten Kirchenarmenpflege», sagt Hungerbühler, «besteht in der Tat der wesentliche Unterschied nur darin, daß bei jenem die Landessteuer dem Bettler zu Haus und Hof getragen wird, während bei diesem der Arme den Steuereinzieher von Gemeinde zu Gemeinde, von Bezirk zu Bezirk selbst in eigener Person machen mußte.»
Deshalb wird nun auch wenigstens bei uns immer mehr am Grundsatz der Lokalisierung der Armenpflege festgehalten, wodurch nicht nur jene Klippen vermieden, sondern auch manche andere mit der gesetzlichen Armenpflege verbundene Übelstände beseitiget werden. Es wird durch sie die Armenpflege gewissermaßen individualisiert. Inwiefern aber die Ausführung dieses Gedankens möglich sei, das vermag ich als ein in der Staatskunst Unerfahrener nicht zu beurtheilen.
Sehr viel Wahres enthält auch die Bemerkung, daß das gesetzliche Armenwesen büreaukratische Verknöcherung in das freie republikanische Volksleben bringe; sie mag besonders diejenigen auf einen großen Mißgriff in der Ausübung des Gesetzes aufmerksam machen, die durch Tabellen und Register bewirken wollen, was nur durch freie persönliche Hingabe erzielt werden kann. Die gesetzliche Armenpflege darf gewiß nicht so verstanden werden, als ob sie der freien persönlichen That entbehren könnte, vielmehr bedarf sie um so mehr derselben, als sie eine gesetzliche ist.
Indessen ist auch wohl zu beherzigen, daß hinwiederum jenes fast sentimentale Verhältniß der Reichen zu den Armen, wie es hie und da als Ideal der freiwilligen Armenpflege gezeichnet wird, auch seine großen Schattenseiten hat und wohl noch weniger demokratisch ist als eine etwas büreaukratische gesetzliche. Das Referat von Zürich bemerkt hierüber in etwas ironischer Anspielung auch einen Ausspruch von Dubs: «Weht’s dich, lieber Demokrat! nicht prächtig jünkerlich an aus diesen Schilderungen mit dem Odem von Jahrhunderten, die vergangen sind samt ihren Herrlichkeiten? Willst du diesen Ton zwischen den Armen und ihren Pflegern? Wohl weiß ich, du willst ganz Anderes, wenn du die Zeit ersehnst, wo die Kirche wie die Madonna Raphaels mit dem Auge der Mutter das geliebte Kind betrachten wird. Aber sieh, Madonnen sind schon etwas Mittelalterliches und ich sage dir, im Leben draussen, dem unvollkommenen, sah ich jenes so schön gedachte Verhältniß mehr als einmal verzerrt in hochmutsvolle Demuth der Reichen und in heuchlerische Kriecherei der Armen; ja, man sah’s schon gemißbraucht zur Erreichung politischer Zwecke und somit völlig entartet. Farblos und nüchtern ist das System, das dem Dürftigen das Recht gibt, das Allernothwendigste zu fordern und dem Volke die Pflicht auferlegt, nach der Schnur des Steuerfußes die Armut mit dem Nothwendigsten zu versehen. Farblos und nüchtern ist dieß Verfahren, aber zugleich gesund, kühl, nervenstärkend, echt republikanisch, gut demokratisch.»
Was aber entschieden für die gesetzliche Armenpflege spricht, das ist der Vortheil, daß nur mit ihr die nötige Polizei und Zucht der Armut möglich ist. Die Nothwendigkeit derselben wird wohl Niemand bezweifeln, der das Leben einigermaßen kennt. «Sie ist nötig», sagt Joh. Hirzel, «eben als gesetzliche, von Gott und Rechtswegen und als, sozusagen, pädagogische Maßregel ganz nach christlichen Grundsätzen. Die rein freiwillige Armenpflege entbehrt eben dieser Zucht, sie kann nur strafen durch Entziehung ihrer Gaben. Eine solche negative Zucht ist hier lange nicht genügend. Es trifft z. B. den pflichtvergessenen Vater gar nicht und macht auch dem Vagabunden nichts, der das oft noch sucht, daß man ihn nur gehen lasse. Seinen Hunger wird er dann schon zu stillen wissen und nicht minder den Durst.»
Diese Nothwendigkeit eines Gesetzes und einer Polizei besonders auch in Beziehung auf den Bettel, geben viele Verteidiger der freiwilligen Armenpflege zu, sie sagen aber, eben dieß sei die Verpflichtung des Staates, den sie sonst von der Armenpflege ausschließen. Auf solches Zumuten erwidert das Referat von Zürich mit Recht: «So?! der Staat soll seine Bürger für die Folgen der Armut quälen bis auf’s Blut, aber für die Armut selbst nichts thun? Er soll den hungrigen Bettler durch seine Gendarmen verfolgen, aber ihn allenfalls auch verhungern lassen? Das ist dann freilich ein Polizeistaat nach bestem Schnitt.» - Überhaupt ist hier zu entgegnen, was jenes Referat an einem andern Orte entwickelt: «Was ist das für eine dürftige, längst antiquirte Ansicht vom Staate, nach welcher er bloß eine Polizei- und Administrationsanstalt ist? Nein, ob wir’s leugnen oder nicht, faktisch ist der Staat schon lange mehr geworden als dieses, er ist jetzt der sittliche Organismus des Volkslebens, in welchem alle wirklich humanen und insofern alle das ganze Volk beschlagende Strebungen ihren Halt und Schutz und ihre Pflege finden. Und die Armenpflege sollte diesem Humanitätsstaat fremd sein?!» Wenn wir auch der Überzeugung sind, daß von Theoretikern und Praktikern mit diesem Humanitätsstaat mancherlei Mißbrauch getrieben worden, so müssen wir doch diese Bemerkung, sofern darunter ein echter Humanitätsstaat verstanden ist, vollkommen unterstützen.
Dieß, verehrteste Herren und Freunde! ist das Verhältniß der freiwilligen und der gesetzlichen Armenpflege in moralischer, national-ökonomischer und politischer Beziehung. Fast möchte ich mit dem verehrten Herrn Referenten aus Zürich Sie fragen: «Wer hat die Schlacht gewonnen? Sagen Sie mir’s, meine Herren; ich bin Ihnen dafür dankbar, denn ich weiß es nicht.»
Das aber dürfte uns klar geworden sein, daß die eine wie die andere Armenpflege in allen drei Beziehungen ihre Berechtigung hat, daß weder die eine noch die andere allein ihre Aufgabe zu erfüllen imstande ist und daher jede in der andern ihre nothwendige Ergänzung findet. Aus den oben angestellten Untersuchungen ergibt sich nun auch einfach und kurz die Antwort auf die zweite Frage:
Könnte der Privatwohlthätigkeit die Armenpflege ganz oder theilweise mit Nutzen anheimgestellt werden? Auf den ersten Theil derselben antwortet Hungerbühler: «Nein und abermal Nein! Es wäre dieß die unnatürliche Rückkehr zu dem alten und veralteten in der Zeit und durch ihre Gebahrung unzulänglich und darum hinfällig gewordenen Systeme, das gegenwärtig auch im Kanton Bern sich gar nicht zu halten vermöchte, wenn nicht eine von Jahr zu Jahr wachsende Staatsarmensteuer, ― das Schlimmste von Allem – an die Stelle der Gemeindsarmensteuer getreten wäre.» Wie richtig diese Bemerkung sei, haben Sie ja erst gestern auch aus statistischen Angaben entnehmen können. Kurz und bündig liegt die Antwort auf diese Frage in folgenden Worten des Referates von Zürich: «Willst du da, wo eine Armengesetzgebung ist, sie einfach beseitigen und diese Angelegenheit, von deren Gestaltung das Wohl und Wehe Tausender abhängt, dem Zufall überlassen? Antwort – natürlich: Nein! Oder willst du in einer Gesetzgebung die Gesetzlichkeit verbieten und die Freiwilligkeit gesetzlich verbieten? Antwort: «So haben’s die Berner anno 1846 getan und haben damit die Gesetzlichkeit der Armenpflege beseitigt und die Freiwilligkeit nicht geschaffen und ihr Armenwesen ruiniert; nein, diesen logischen Widerspruch und praktischen nonsens will ich auch nicht.»
Der Freiwilligkeit darf also in unsern Verhältnissen die Armenpflege ohne Schaden nicht ganz überlassen werden. «Schön wär‘s», bemerkt das Zürcher Referat, «wenn alle Unterstützungsbedürftigen und Unterstützungsfähigen sittlich-religiöse Menschen wären, dann brauchte es kein äußeres Gesetz, das innere würde hinreichen, damit Alles, und Alles recht, getan würde. Aber es heißt die Welt leugnen und Gott korrigiren, wenn man voraussetzt, die Menge der Menschen werde je diese Vollkommenheit erreichen. Vielen ist das sittliche Gesetz als das Ideal, das sie leitet, ins Herz geschrieben; sie kümmert nicht, sie geniert und hemmt nicht das äußere Gesetz. Die Mehrzahl der Menschen aber bedarf’s vermöge ihrer sittlichen Unvollkommenheit, daß, was gut und schön ist, als Gesetz über und ausser ihnen walte. Sie folgen ihm und thun damit ihre Pflicht; ohne das Gesetz thäten sie dieselbe nicht. Darum sind die Völker glücklich zu preisen, welche weit genug fortgeschritten sind, um sich selbst die Wohlthätigkeit als ein Gesetz aufzulegen, dem Keiner entgehen kann; sie stehen höher als diejenigen, wo nur die Minderzahl der edlen und freien Geister das erfüllt, was die Pflicht Aller wäre, und wo die Mehrzahl für die Nothleidenden entweder Nichts thut, oder was sie noch thut, nur in abergläubiger Stumpfheit oder in raffinierter Klugheit vollbringt.»
Doch alle diese Bemerkungen gelten eigentlich dem nicht, was die Verteidiger der freiwilligen Armenpflege wollen. Sie denken nicht sowohl an jene sporadisch wirkende in einzelnen wohltätigen Vereinen auftretende Freiwilligkeit, sie wollen die freiwillige Armenpflege als kirchliches Institut, kirchlich und nicht staatlich organisirt. So die oben angeführten Vertreter: Chalmers, Dubs, Baumgarten u. A. Es sei seine Überzeugung, sagt Dubs, «daß zur Leitung einer derartigen Organisation der Staat mit seiner rein äußerlich hanthierenden Polizei viel weniger Beruf und Geschick hat, als die in allen Gemeinden durch religiös und humanistisch gebildete Männer vertretene Kirche, mit jener mächtigsten innern Waffe, der Liebe.»
Es hat diese Anschauung sehr viel für sich, und wäre sie realisirbar, so wie neulich jene Vertreter sie verwirklicht wissen wollen, so müßten wir zu ihr als dem Ideal der christlichen Armenpflege unbedingt stimmen. Die christliche Gemeinde, in weiterm Sinne die christliche Kirche, sollte nach dem Urbild der ersten brüderlichen Gemeinschaft es sein, welche durch innern lebendigen Organismus die freiwilligen Gaben würdig vertheilte und mit der äußern auch die innere Unterstützung böte. Es ist auch nicht zu leugnen, daß in einer kirchlichen Armenpflege am ehesten jene Nachtheile der beiden andern Systeme zu vermeiden wären; das Zufällige und Sporadische der freien Armenpflege nämlich durch eine innere über das Ganze sich verbreitende Organisation; das Äußerliche und Veräußerlichende der gesetzlichen durch geistige Vertiefung und seelsorgerisches Wirken.
Doch, alle diese Pläne und Wünsche, so schön sie auch gedacht sein mögen und so wahr sie auch sind in ihrer Idee, werden noch lange ein pium desiderium bleiben und das zwar aus zwei Gründen. Für’s erste nämlich ist nach dem jetzigen Stand der Dinge gar nicht abzusehen, daß der Staat in der Mehrzahl seiner Vertreter sich gutwillig dazu verstehen möchte, diese Pflicht und dieses Recht der Kirche abzutreten, woran so viele Konsequenzen hangen und wodurch der Grundsatz, daß die Kirche keine Macht sein dürfe im Staat, wenn nicht umgestoßen, doch gewaltig erschüttert würde. Wenn z. B. ein Staat wie Baselland in der Geltendmachung dieses Grundsatzes so weit geht, die Kirche auch nur von der Theilnahme an der Verwaltung der ihr so verwandten Gebiete, des Schul- und Armenwesens auszuschließen, so daß der Geistliche es als eine große Ehre und Bevorzugung ansehen muß, wenn er in das Armenwesen seiner Gemeinde dadurch einen Blick erhält, dass man ihn etwa zum Schreiber macht, weil man ihm die Arbeit gerne aufbürdet, - so ist von einem solchen Staat noch lange nicht zu erwarten, daß er dem System einer kirchlichen Armenpflege huldigen werde. Die Verwirrung, die an manchen Orten hervorgerufen würde, möchte wohl weit größer und bedenklicher sein als das Gute, das dabei herauskäme.
Sodann aber müssen wir auch von der Kirche sagen, daß, wie sie überhaupt nicht mehr in der ursprünglichen Reinheit besteht, so auch ihre Armenpflege in der Wirklichkeit jenem Ideal nicht entsprechen würde. Sehr wahr und schön bemerkt das Referat von Zürich: «Wo wäre ein Seelsorger, dem nicht das Herz freudiger pochte, wenn er auch heutzutage einen Augenblick die Kirche sich realisirt denkt nach dem Urbilde der ersten Gemeinde, die mit aufopfernder Liebe ihre Armen versorgte, daß sie keinen Mangel litten. Wo wäre Einer, der nicht in einem Augenblicke evangelischer Begeisterung sich versucht fühlte zu sagen: ‹Wir wollen’s probiren; der Geist des Evangeliums, der heilige Geist ist auch uns noch gegeben und gelassen!› - Aber es harrt dieser Begeisterung die gründliche Abkühlung, es ist ja in der Landeskirche dasselbe Volk, welches den Staat und welches die Kirche bildet. Wenn das Volk als Staat des Gesetzes bedarf, wird’s denn auf einmal als Kirche so hoch stehen, daß es Alles in begeisterter Freiwilligkeit tut? Das ist durchaus unwahrscheinlich. Also müßte die Kirche, das Armenwesen übernehmend, wieder einen gesetzlichen Organismus sich schaffen; somit hätten wir dann die Gesetzlichkeit, anstatt jetzt im Staate, wo sie hingehört, in der Kirche, wo sie nicht hingehört; wir hätten wieder den Katholizismus; denn er ist die gesetzlich gewordene Kirche.»
In diesem Sinne sagt auch Hungerbühler: «Der Staat kann dem Einfluss der Kirche, so hoch wir auch denselben anschlagen, kann der Macht der religiösen Moral, welche die Armenfürsorge gebietet, unter waltenden Umständen nicht mehr ausschließlich vertrauen, um auch nur die dringendsten Bedürfnisse seiner nothleidenden Angehörigen zu befriedigen, geschweige um die ganze Armenpflege der Privat- und Vereinswohlthätigkeit zu überlassen.» Schluß aus dem Allem ist: daß der Privatwohlthätigkeit, resp. auch der Kirche, die Armenpflege nicht gänzlich mit Nutzen anheimgestellt werden darf. Ebenso sehr ist aber auch nach all dem Gesagten zu betonen, daß der Staat nicht soll die Armenpflege, die in ihrem Grund und Wesen auf der persönlichen Liebe ruht, mehr in die Hand nehmen wollen, als es die Nothwendigkeit gebietet. Aus demselben Grunde ist es nicht recht, wenn er die Kirche, die am ehesten in ihren Vertretern mit der äußern Pflege auch die innere verbinden und, wie es gefordert wird, moralisch und seelsorgerisch auf die Unterstützten einwirken kann, von aller und jeder Theilnahme an der Armenpflege ausschließt. Es ist jene geistige Einwirkung nur möglich und von Erfolg, wenn auch die Möglichkeit einer äußern Berührung und Anknüpfung gegeben ist. Und, abgesehen davon, daß die Kirchen deren Almosen zum Armengut geschlagen werden, nicht nur ein Interesse, sondern ein gewisses Recht zur Betheiligung an der Verwaltung hat, dürfen wir wohl mit Zuversicht behaupten, ohne unsern Stand zu sehr zu erheben, daß durch die Gegenwart eines jeden rechtschaffenen Geistlichen im Armenkollegium manche jener groben Mißgriffe verhütet würden, die sich eine leider nicht immer aus den gewissenhaftesten Männern zusammengesetzte Armenpflege oft erlaubt.
Unsere Antwort auf die in Lemma 2 gestellte Frage geht also, in Übereinstimmung mit den uns zugekommenen Bemerkungen von Seiten vieler hochverehrten Mitglieder dieser Gesellschaft dahin, daß die freiwillige und die gesetzliche Armenpflege, jede in ihrem Bestehen berechtigt, sich in die Arbeit zu theilen haben, und daß nur in gegenseitiger Anerkennung und möglicher Übereinstimmung des Wirkens das Heil erblühen könne. Gerade darin, daß bei uns gesetzliche und freiwillige Armenpflege Hand in Hand gehen, hat ein hochverehrtes Mitglied unserer Gesellschaft den Grund eines bessern Zustandes unseres Armenwesens gefunden, als in manchem andern Kanton wir ihn erblicken. Dieß führt uns auf die dritte Frage:
Welche Theile sollen der freiwilligen und welche der gesetzlichen zufallen und welche Mittel stehen beiden zu Gebote?
Die Vermuthung, welche das Referat von Zürich ausspricht, es verlange diese Frage die Aufstellung eines solchen Verhältnisses, bei welchem der Privatwohlthätigkeit ein abgegrenzter Theil, ein bestimmtes Gebiet, und der gesetzlichen ein eben solches zur ausschließlichen Bearbeitung überwiesen würde, ist wohl nicht unbegründet. Ich glaube, das ist der Sinn dieser Frage, die unsern Verhältnissen entsprungen ist, und noch in der letzten Sitzung, wo bei uns dieser Gegenstand besprochen wurde, verlangte man besonders Auskunft über eine solche Theilung.
Das Referat von Zürich benimmt uns aber von vorneherein alle Hoffnung auf solchen bestimmten Entscheid mit der Bemerkung: «Daß diese mechanische Theilung nicht möglich und nicht statthaft sei, ergab sich aus den Verhandlungen unserer Kommission, in welcher ja Versuche solcher Art wohl unternommen, aber auch in ihrer Vergeblichkeit erwiesen worden sind.»
Bei einigem Nachdenken wird man sich auch von der Wahrheit dieser Bemerkung überzeugen, insofern nämlich eben von einer äußern Theilung die Rede ist. Gesetzt auch, man könnte der gesetzlichen Armenpflege solche abgegrenzte Gebiete zuweisen, wie z. B. die armen Kranken oder die verschuldeten Unterstützungsbedürftigen, so wird sich doch dieß bei der Privatwohlthätigkeit nicht thun lassen, indem man ihr nicht vorschreiben kann, welche Gebiete sie bearbeiten solle oder nicht, falls man sie nicht beschränken und wieder zu einer gesetzlichen machen will. Gerade hierin liegt aber die Erklärung, warum unsere Frage so gestellt wurde, indem bei uns die Privatwohlthätigkeit, sofern sie in Vereinen, resp. im Armenerziehungsverein wirkt, selbst wieder fast ausschließlich gesetzlicher Natur ist und von einem der höchsten Regierungsmitglieder dirigirt wird (was freilich, wenigstens nach meiner Ansicht, nicht geschehen sollte). Sonach besteht bei uns die freiwillige Armenpflege, wenigstens diejenige, auf die hier besonders Rücksicht genommen ist, nur dem Namen nach, im Grunde ist sie wieder eine gesetzliche, nur mit sehr viel Elementen der freiwilligen versetzt, die aber nicht sowohl in der Sache als vielmehr in einigen dabei betheiligten Personen liegen.
Aber auch abgesehen hievon, ist eine solche äußerliche Theilung unmöglich oder doch unhaltbar aus dem Grunde, den wir oben zur Empfehlung der gesetzlichen Armenpflege angeführt haben; daß nämlich die freie Armenpflege als eine freie eine sehr unsichere ist und daß ihre Wirksamkeit sehr von der zufälligen Begeisterung oder Erschlaffung, von guten und bösen Zungen abhängt; so daß vielleicht die ihr zugewiesenen Gebiete das eine Mal, wir wollen nicht sagen zu viel, aber doch besser, das andere Mal gar nicht kultivirt würden, und dann doch wieder die gesetzliche eintreten müßte.
Endlich ist es schwierig, jedem Systeme gerade die Gebiete zuzuweisen, die seiner Natur entsprechen. «Im Bestreben», sagt Heinr. Hirzel, «der Privatwohlthätigkeit ein bestimmtes einzelnes Gebiet zuzuweisen; ferner in der Voraussetzung, sie übe eine beweglichere fluktuirende Wirksamkeit, wollte ihr die Besorgung der vorübergehend Hilfsbedürftigen zugewiesen werden. Es wurde aber gezeigt, daß gerade dieser Zweig des Armenwesens der Verhältnißmäßig geringfügigste, und daß diese Leistung der Privatwohlthätigkeit somit auch eine Verhältnißmäßig sehr geringe wäre. Zudem muß nicht bloß in quantitativer, sondern in prinzipieller Hinsicht gesagt werden: insofern die Besorgung der Kranken in dieses Gebiet einschlägt, ist es dasjenige, auf welchem gerade die der Privatwohlthätigkeit am weitesten obliegende Macht, nämlich die staatliche Obsorge ihm gewidmet sein soll. Nach dem Urtheile der kompetentesten Organisatoren der freiwilligen Armenpflege soll ja der Staat für diejenigen einstehen, deren Unterstützung theils in keinem Falle Nachahmung erweckt, theils den Gemeinden aus Mangel an Anstalten unmöglich ist. Dahin gehört neben der Versorgung der Unheilbaren auch die Verpflegung der akut schwer Erkrankten in der Staatsanstalt des Spitals. Weil dieser Versuch als ein unstatthafter konnte erwiesen werden, so wurde dann probirt, ich weiß nicht recht ob die Verpflegung der Alten und Gebrechlichen, oder die Erziehung der Kinder der Privatwohlthätigkeit zuzuweisen. Ein geschickter Anwalt könnte gewiß für jedes dieser beiden Gebiete Gründe aufstellen, welche scheinbar machen würden, daß das Eine oder das Andere der einen oder andern Armenpflege zu überlassen sei. Aber wir vermissen bei allen diesen Theilungen ein festes normirendes Prinzip, und sie werden daher auch im Leben nie als haltbar sich bewähren.»
«Daher trieb es uns in unsern Verhandlungen schon von Anfang an, ein gleichsam dynamischeres Verhältniß zwischen den zwei Systemen aufzustellen. Es schwebte uns vor, beide Systeme sollen die ganze Armenpflege üben; wir schieden also nicht räumlich, wir schieden vielmehr gleichsam zeitlich, indem wir eine Reihenfolge suchten, in welcher beide, übers ganze Gebiet sich verbreitend, in Aktion treten sollen.» Die Richtigkeit eines solchen Theilungsprinzipes ergibt sich nicht nur aus der Unmöglichkeit einer äußern Theilung, sondern auch daraus, daß freiwillige und gesetzliche Armenpflege wohl in einem Gefühl des Richtigen jede das ganze Feld, nur jede in ihrer Weise bebauen will.
Es handelt sich also nicht sowohl um eine Vertheilung der verschiedenen Gebiete als vielmehr um ein Sichtheilen in die ganze Arbeit; es kann nicht gezeigt werden, welcher Zweig des Armenwesens dem einen oder dem andern System zur Bearbeitung zufalle, sondern in welcher Weise jedes auf dem ganzen Felde wirksam sein solle und welche Art der Thätigkeit dem einen und dem andern entspreche.
Im Ganzen und Allgemeinen wurde nun dieses Verhältniß in den Verhandlungen der zürcherischen gemeinnützigen Gesellschaft sehr anschaulich in einem Bilde dargestellt. Hr. Dubs verglich es nämlich mit dem Bundesauszug und der Reserve. Der Bundesauzug, die freiwillige Armenpflege, soll zuerst einschreiten, namentlich die individuellen vorübergehenden Fälle behandeln, die Reserve, die gesetzliche Armenpflege, nur im Nothfall, wo jene erschöpft ist.
Hr. Dr. Zehnder dagegen wollte eher der gesetzlichen Armenpflege die Stellung des Auszugs einräumen oder wenigstens einer Reserve, die sich auch nicht selten entscheidend ins erste Treffen stellen dürfte. Nach dem oben Entwickelten, nach welchem wir die gesetzliche Armenpflege als nothwendig gewordene und noch immer als nothwendig sich erweisende Ergänzung der freien ansehen müssen, haben wir ihr die Stellung als Reserve einzuräumen, sie hat einzutreten, wo die freiwillige nicht ausreicht, nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht. «Das scheint mir eine verkehrte Ordnung», sagt Joh. Hirzel, «wenn es heißt: ‹zuerst die gesetzlichen Steuern, dann, wo diese nicht ausreichen, freiwillige ergänzende Nachhilfe›, weil diese dann ja schon nicht mehr freiwillig ist. Der freien Liebe Sache ist es durchaus, anzufangen, zuvorzukommen; darin liegt auch der Reiz und der Segen der freiwilligen Armenpflege. Ihre Aufgabe ist es, den Armenbehörden so viel als möglich Bedürftige vorwegzunehmen, bis ihr am Ende kein würdiger, unverschuldeter Armer mehr gelassen würde.»
Ich glaube, von solchen richtigen Voraussetzungen sollte jedes vernünftige Armengesetz, wie das neue zürcherische es auch tut, ausgehen; der leitende Grundsatz sollte sein, der Privatwohlthätigkeit möglichst freien Spielraum zu geben und sich von ihr möglichenfalls auch ganz verdrängen zu lassen, dagegen als Aufgabe es zu erkennen, das Minimum zu geben, was auch dem Schlechtesten geschuldet wird, und damit die ihr zustehende gehörige Zucht zu verbinden.
Das Referat von Zürich sagt hierüber: «Wirklich, so und nicht anders ist es begreiflich und erfahrungsgemäss, die gesetzliche Armenpflege gibt dem Volke, oder in ihr gibt sich das Volk selbst die Garantie, daß kein Armer vergessen, keiner in seiner wirklichen Noth verlassen sei. Diese Garantie gibt die Freiwilligkeit nicht. Das ist das eigentliche Wesen der gesetzlichen Armenpflege, daß sie dem Armen nicht nachgeht, ihn aufzusuchen, daß sie ihn aber aufnimmt, wenn er als wirklicher Hilfsbedürftiger zu ihr kommt; sie nimmt ihn als solchen auf, ob er verschuldet oder unverschuldet, würdig oder unwürdig sei; in beiden Fällen gibt sie ihm den nothwendigsten Unterhalt.
Die freiwillige Armenpflege dagegen geht dem Armen nach, sucht ihn auf, gibt ihm auch das Nothwendigste von leiblichen Gaben, fühlt aber dieses immer nur als den unwesentlichern Theil ihrer Aufgabe und als den wesentlichern die bessernde hebende Einwirkung auf die Gesinnung und das Leben des Hilfsbedürftigen.»
Wenn es nun aber darauf ankommt, die oben bezeichnete Theilung vorzunehmen und Jedem seine Thätigkeit, gewissermaßen sein Gebiet anzuweisen, so erheben sich hier neue Schwierigkeiten. Es läßt sich nicht Alles ins Einzelne genau bestimmen, es lassen sich nur allgemeine Gesichtspunkte aufstellen. Sehr viel Ansprechendes hat der Vorschlag des Hrn. Dekan Häfeli, er sagt: «Ein Fehler liege wohl darin, daß die heilende Salbe und die strafende Rute in einer Hand vereinigt seien, so daß das eine nicht erkannt werde und das andere doch nicht weich mache. Also theile man. Die Frage sei nicht die: entweder gesetzliche oder freie Armenpflege? sondern sowohl die eine als die andere? Aber man scheide die würdigen Armen von unwürdigen nach verschiedenen Stufen: sogar zwei verschiedene Pflegen seien ganz am Platze. Es sei unlogisch, daß der Staat prätendire das Armenwesen zu besorgen, und es doch durch den Stillstand tue. Für die würdigen Armen also sorge die Kirche, gleichsam halboffiziell in der Mitte stehend zwischen der ganz freien Privatwohlthätigkeit und der rein staatlichen Armenpflege, welche durch den Gemeinderath über die selbstverschuldeten Armen geübt werden soll und zwar mit allen polizeilichen Mitteln der weltlichen Gewalt.»
«Es ist dieses System fein und sauber gedacht», wie Heinr. Hirzel sagt, «jeder Funktion ist das ihr eignende Organ gegeben und alle Organe sind zu einem Gesamtorganismus gut verbunden.» Es hat aber auch seine schwachen Seiten und wohl nicht zu überwindende Schwierigkeiten. Die gesetzliche polizeiliche Armenpflege soll, wozu sie am wenigsten geschickt ist, die Individualitäten prüfen und über ihre Würdigkeit oder Unwürdigkeit entscheiden; wobei sie wohl auch nicht ermangeln wird, aus ökonomischem Interesse so viel Würdige als möglich der kirchlichen Armenpflege zuzuweisen. Überhaupt aber ist ein solches Unterscheiden zwischen Würdigen und Unwürdigen etwas Mißliches, Unsicheres, und Willkürliches und kann leicht, wie Joh. Hirzel mit Recht bemerkt, zu einem falschen Pharisäismus führen. Auf der andern Seite ist in diesem System der Freiwilligkeit wieder ein Zwang angetan, der ihrer Natur widerstrebt und ihre Wirksamkeit beeinträchtigt und hemmt. Jedenfalls würde die Folge davon statt treuen übereinstimmenden Wirkens vielfaches Auseinandergehen sein, das dem Ganzen nur schaden kann.
Nichts desto weniger liegen in diesem Vorschlag treffliche Winke über die Art und Weise, in welcher jede Armenpflege wirksam sein soll. Wir werden nämlich darauf aufmerksam gemacht, daß jede von ihnen nur die Gebiete bebauen und die Thätigkeit üben solle, die ihrer Natur entspreche. Von diesem Gesichtspunkt können wir allein ausgehen, wollen wir eine Theilung der Arbeit versuchen. Noch besser bezeichnet denselben Hr. Johannes Hirzel, wenn er auf das Verhältniß von gesetzlicher und freiwilliger Armenpflege dasjenige von Gesetz und Evangelium anwendet. Sehr wahr und zu beherzigen ist, was er hierüber bemerkt, wenn er sagt: «Wenn auch der Staat als der Organismus zur Verwirklichung der Totalität der sittlichen Zwecke gefaßt wird, und wenn von einem christlichen Humanitätsstaat die Rede ist, so ist und bleibt er doch zu allererst Rechtsanstalt, und Alles ist ein Schaden, was diese seine erste Stellung verrückt. Auch seine höhern und sittlichen Kultur- und Humanitätszwecke fördert er am sichersten, indem er die diesen gewidmeten Anstalten mit seinem Recht und Gesetz schützt, die verschiedenen Lebensgebiete, z. B. der Industrie, der Wissenschaft, der Kunst, der Religion, jedes nach seinen eigentümlichen innern Prinzipien anerkennt.»
Dieß auf das Verhältniß von gesetzlicher und freiwilliger Armenpflege angewendet, ergibt sich zunächst, daß der Staat als sittlicher Organismus im Allgemeinen über die rechte Pflege des Gebietes des Armenwesens zu wachen hat, indem er die freien Bestrebungen durch Gesetze hebt und schützt, und durch kräftige Handhabung der Zucht, wozu er allein befugt ist, unterstützt – und indem er, wo die Freiwilligkeit nicht ausreicht, selbsttätig eingreift durch besondere Verordnungen und Gesetze. Doch auch hiebei wird er an die Freiwilligkeit anknüpfen und von den natürlichen Pflichten ausgehen, die er, wenn sie nicht befolgt werden, gebietet; so nämlich, daß er in erster Linie die Familie, soweit es nämlich ohne Beeinträchtigung sich thun läßt, in zweiter Linie die Gemeinde und erst in letzter Linie und im äußersten Nothfall sich selbst zur Unterstützung verpflichtet. In diesem Sinne ist gewiß sehr vernünftig das neue zürcherische Armengesetz durchgeführt. – So wird der Staat aber als Organismus des Ganzen es nicht sowohl mit den speziellen Verrichtungen, mit der individuellen Besorgung zu tun haben, sondern diese so viel möglich der Freiwilligkeit überlassen, als vielmehr nur mit der Ordnung im Ganzen. In diesem Sinne sagt das Referat von Zürich, die Festigkeit der gesetzlichen Armenpflege sei die Ergänzung für die Zufälligkeit der freien.
Sodann hat der Staat, wie schon oben angedeutet worden, das Recht und die Pflicht der Zucht und der Beaufsichtigung der Verwaltung, soweit sie gesetzlich geordnet ist. Gerade hierin sollte er seine Hauptaufgabe suchen, dieweil er nicht um sonst die Gewalt in der Hand hat. Es hat ein hochverehrtes Mitglied der zürcherischen gemeinnützigen Gesellschaft bei der Behandlung dieser Frage gesagt: «Wir leben in der Zeit der Assekuranzen, wo der Geschädigte vom Staat, nicht vom Einzelnen Entschädigung verlangt», und es ist damit so ziemlich klar das Wesen der gesetzlichen Armenpflege ausgesprochen. Wohlan aber, wenn der Staat dem Einzelnen solche Garantien gibt, dann ist es auch sein Recht, nein seine heilige Pflicht, auch vom Einzelnen sich gegenüber Garantien zu verlangen, und, wo sie nicht geleistet werden, sich derselben zu versichern – oder dem Einzelnen nichts mehr zu schulden. Solange nicht durch einschlägliche Gesetze und strenge Handhabung derselben dem Unterstützten ins Bewußtsein gebracht wird, der Staat sei nicht nur ihm etwas schuldig, sondern er auch dem Staat, muß eine gesetzliche Armenpflege vom Übel sein. Hieher gehört, was oben vielfach von Restriktionen der gesetzlichen Armenpflege gesagt wurde. Und wenn in dem Zürcher Armengesetz den Unterstützungsbedürftigen, resp. den Vätern, deren Kinder man unterhalten muß, das Wirtshausgehen u. dgl. verboten, wenn über ihren Fleiß und ihre Thätigkeit gewacht wird, wenn Leichtsinnige hart bestraft werden, so kann ich darin keine Verletzung der Menschenwürde sehen; es ist hier nur durch das Gesetz bestimmt, was ein rechtschaffener, frommer Armer aus freien Stücken thun müßte. – Und zwar möchten wir das Gesagte nicht nur angewendet wissen auf die schon Unterstützungsbedürftigen, sondern auch auf die, welche auf dem besten Wege sind, es zu werden. Wenn der Staat die Armennoth so viel möglich heben will, so sollte er vorerst seine beste Kraft daran wenden, die Quellen der Armut zu verstopfen durch strengere Wirtschaftspolizei, durch ernstere Ehegesetze u.s.w. Doch ich will dieses Kapitel nicht weiter verfolgen, ich könnte mich zu lange daran aufhalten, es fehlt überhaupt an Wissen nicht. – Es wäre auch schon viel gewonnen, wenn nur mit dem Bestehenden rechter Ernst gemacht würde und die Armensache im Staat nicht nur durch Gesetze, sondern durch eine förmliche Verwaltung repräsentirt wäre. Es wäre zu wünschen, daß z. B. die Gemeindsarmenpflegen unter der strengen Aufsicht einer solchen Verwaltung ständen und stets über ihr Thun und Lassen Rechenschaft abzulegen hätten. Wohl vielem Leichtsinn und vieler Ungeschicklichkeit könnte dadurch vorgebeugt werden. Sehr schön sagt hierüber Hr. Hungerbühler: «Wenn die Regierung und die betreffende Rathsabtheilung die Verrichtungen und Verpflichtungen der Gemeindsarmenpflegen theils selbst, theils durch das Organ ihrer Statthalter in den Bezirken genau überwachen, so üben sie mehr als eine bloße verfassungsmäßige Prärogative aus; sie erfüllen eine heilige Pflicht, die, je verantwortungsreicher von Jahr zu Jahr dieser Zweig der öffentlichen Verwaltung wird, um so mehr an Umfang und Bedeutung gewinnt.»
Was sodann die Privatwohlthätigkeit betrifft, so können wir ihr als einer freien keine besondern Vorschriften geben, sie soll nach allen Seiten hin sich frei entfalten. Wohl aber ist uns erlaubt, Winke zu geben, welche Stellung ihrer Natur gemäß sie zu der gesetzlichen einnimmt oder einnehmen sollte. Und da sind besonders zwei Punkte hervorzuheben, die auch das Referat von Zürich betont: «Ihre Thätigkeit ist nämlich einestheils eine der Armut vorbauende, anderntheils eine die Bestrebungen der gesetzlichen ergänzende. Die freiwillige
Armenpflege baut der Armut vor durch Errichtung und Organisation solcher Institute, wodurch die Armen zu einer solchen weisen Benützung ihrer Kräfte angeleitet werden, daß sie ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Wechselfälle des Schicksals ertragen können. Solche Institute sind Alters-, Kranken-, Spar- und Leihkassen etc. Der Segen dieser Thätigkeit ist um so größer, als dadurch nicht nur äußerlich Hilfe geleistet, sondern oft und viel auch jenes Gefühl der Selbständigkeit erweckt und Selbst- und Gottvertrauen erhalten wird, das am besten vor Unterstützungsbedürftigkeit schützt. Ebenso baut die freiwillige vor, indem sie armen Eltern bei Erziehung ihrer Kinder behilflich ist*, und bei würdigen Armen durch rechtzeitiges Einschreiten der Gefahr der Almosengenössigkeit vorbeugt.
Ergänzend wirkt die Privatwohlthätigkeit dadurch, daß sie die Leistungen der gesetzlichen Armenpflege erweitert, vertieft und vergeistigt, wie das Referat von Zürich sich ausdrückt. Sie tritt mit der Milde des Evangeliums ein, wo das Gesetz vorangegangen, sie verbindet mit der äußern Unterstützung die geistige sittlich-religiöse Erhebung der Armen. Hier hat allerdings die Kirche ein großes und reiches Feld der Wirksamkeit. «Die Geistlichkeit», sagt Hr. Hungerbühler, «hat vor Allen die glückliche Macht, zu den Wohltaten, die der Arme genießt, sittliche Anleitung und die heilsamsten Tröstungen zu geben.»
Wenn nun aber der gesetzlichen Armenpflege mehr die im allgemeinen organisirende und polizeiliche, der freiwilligen dagegen die auf das Individuum eingehende, den Einzelnen hebende Seite der armenpflegerischen Thätigkeit zukommt, so ist es gut, ja nothwendig, daß beide zueinander in innige Beziehung treten, nicht so, daß die freiwillige wieder gesetzlich gemacht wird, wohl aber so, daß sie gleichsam dem Gesetze sich zu Diensten stellt, wie sie andererseits dessen Schutz in Anspruch nimmt. Wo z. B. besonders individuelle Behandlung nothwendig ist, wie bei der Versorgung der Kinder, bei Verkostgeldung momentan Erkrankter, die man nicht ins Spital thun kann; da sollte die freiwillige Armenpflege eingreifen und die gesetzliche durch Hilfleistung in Geld und durch ihren Schutz sie unterstützen. Es ist in dieser Beziehung bei uns Schönes angebahnt worden, und wenn auf diesem Grunde weiter gebaut wird, kann noch Schöneres erzielt werden.
Dieß, verehrteste Freunde, sind im Allgemeinen die Gesichtspunkte, welche ich über die Art, wie sich gesetzliche und freiwillige Armenpflege in die Arbeit zu theilen haben, aufzustellen wüßte. Es bliebe uns nun noch übrig, die Mittel anzugehen, die jeder zu Gebote stehen. Die Antwort auf diese Frage ist theilweise schon in dem Vorhergehenden gegeben und nur noch einzelne Bemerkungen und Andeutungen mögen Sie mir erlauben.
Das erste und wirksamste Mittel ist nicht, wie viele glauben, Geld und wieder Geld; so sehr dieß auch in den Vordergrund tritt. Das erste Mittel sollte man stets suchen im Herzen der Armen selbst. Den Grund, der in ihnen selber liegt, recht fruchtbar zu machen, die Kräfte, die ihnen zur Beförderung ihres Wohles gegeben sind, sie recht fühlen zu lassen, das Selbst- und noch mehr das Gottvertrauen in ihnen wecken und zu stärken, das sollte jede Armenpflege als ihre erste Pflicht ansehen. Hier kann privatim unglaublich viel geleistet werden, ohne daß es das Geringste kostet. Es gibt, wenn ich nicht sehr irre, in Basel Fabriken, wo kein Arbeiter geduldet wird, der nicht von Zeit zu Zeit ein Gewisses in eine Sparkasse legt und wo noch ähnliche zum Wohl der Arbeiter dienende Bedingungen gestellt werden. Könnten nicht alle Herren Fabrikanten dieß einführen? Die Folgen davon könnten keine andern sein, als daß sie vielleicht einiges Widerstreben finden und mißbeliebige Äußerungen hören müßten, dafür aber um so arbeitsamere und treuere Leute besäßen, die ihnen am Ende doch noch dankbar wären. Und wie viel Gutes zur Hebung ihrer Arbeiter, ohne irgend ein Opfer, können nicht Fabrikherren dadurch stiften, daß sie einsichtsvolle gesinnungstüchtige Meister und Aufseher anstellen, die das Herz für ihre Mitbrüder auf dem rechten Flecke haben. Ich wünschte, Sie mit solchen Männern und ihrem Wirken, wie ich aus eigener Anschauung sie kenne, Sie bekannt machen zu können. Und sind jene freiwilligen Bestrebungen, wie sie in Alters-, Kranken- und Sterbekassen sich kund geben, nicht bedeutsame Winke für den, der hier thätig sein will, an welchem Orte er die Hand anlegen solle?
Wo aber jenes nun doch einmal unentbehrliche Mittel, das Geld angewendet werden muß, so wäre der Privatwohlthätigkeit, sowohl zum Zweck dasselbe erhältlich zu machen, als auch es gut zu verwenden, hier der gute Rath des Referates von Zürich zu geben: «Es sei die freiwillige Armenpflege so dezentralisirt wie möglich. Möglichst für jeden Zweck ein eigenes Organ, eine eigene Kasse. Denn es sind der Wohlthätigkeitsliebhabereien gar viele im Publikum, und gut ist’s und für die Ökonomie aller Zweige sehr förderlich, wenn es jedem Wohltäter möglich ist, gerade derjenigen Art und Klasse von Nothleidenden, für die er am meisten Sympathie empfindet, seine Gaben in ungetheilter Reichlichkeit zufließen zu lassen. Der Rapport aller verschiedenen Zweige läßt sich immerhin herstellen.»
Die gesetzliche Armenpflege wird ihre Mittel immerhin nur auf dem gesetzlichen Wege wie bisher aufzubringen wissen. Steuern und besondere zu diesem Zwecke errichtete Abgaben werden die Zuflüsse der Armenkasse bleiben. Wünschbar ist in allen Fällen die Anlegung von Armenfonds, und noch mehr die Erhaltung und Äufnung derselben, wo solche bestehen. Sehr zu beachten ist gewiß auch der gute Rath, daß die Leistungen eben sowohl in Natura als in Geld bestehen können, besonders in Landgemeinden; theils weil solche Steuern mit weit mehr Bereitwilligkeit und mit weniger Mühe vom Bauersmann entrichtet werden, theils auch weil sie für den Armen nachhaltiger wirken, der doch oft das Geld nur ungeschickt verwendet. Es werden freilich beide Armenpflegen in diesem Stücke oft rathlos sein, doch haben wir auch den guten Trost, daß Liebe und Noth erfinderisch machen.
Wir sind am Schlusse unserer Arbeit angelangt, in der ich, so gut es in meinen schwachen Kräften stand, Ihnen die verschiedenen Ansichten vorlegte und beleuchtete. Mögen Sie mir die lange Geduldprüfung, mit der ich Sie hingehalten habe, und die Unvollkommenheit meiner Arbeit verzeihen. Die Frage selbst wird nie zu Ende besprochen werden können, und die Lösung derselben müssen wir einer höhern Hand anvertrauen, die immer die rechten Mittel und Wege weiß, wo auch der Menschen Auge keinen Ausweg mehr findet. Ich möchte zum Schlusse nur noch das Wort Ihnen ans Herz legen, das Joh. Hirzel aus dem Munde eines Staatsmannes uns mittheilt und das mir zum großen Trost gereicht hat: «Jeder thue an seinem geringen Ort, was er nach seinen Kräften und seiner Einsicht kann, und sei zufrieden, daß er für den Gang des Ganzen, der in höherer Hand liegt, nicht verantwortlich ist. Das ist die beste Errungenschaft der letzten Jahre.» - Dixi.
*Gerne bitte ich, wenn Raum und Zeit es mir gestatten, dieses Kapitel weiter ausgeführt und nicht nur auf die Nothwendigkeit und den Segen von Kleinkinderbewahranstalten, von Kinderspitälern etc. hingewiesen, sondern auch besonders für Fabrikgegenden solchen Anstalten gerufen, wo arme Eltern ihre Säuglinge gegen ein erträgliches Kostgeld gut versorgen können, statt daß sie dieselben oft um ein bedeutendes Opfer an solchen Orten theils aus Unkenntniß, theils aus Nothdurft, theils aus Leichtsinn unterbringen, wo sie schon in der zartesten Jugend an Leib und Seele zu Grunde gehen müssen. Wie viel Gutes könnte damit für die Eltern wie für die Kleinen gestiftet werden. Überhaupt steht hier der Privatwohlthätigkeit ein reiches und überaus gesegnetes Feld des Wirkens noch offen.